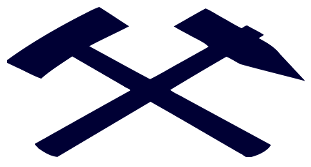Anläßlich des vierzigsten Todestages Wiktor Kramskis (1893-1962) gibt der Förderverein der poettischen Kultur an dieser Stelle Hans-Günther Wowereits Artikel Wiktor Kramski – Nachdenklicher Vordenker wieder, der zuerst im Mai 1978 in den Freiburger Stimmen erschien. Es ist frustrierend hier konstatieren zu müssen, daß die damals von Wowereit festgestellte Ignoranz hinsichtlich dieses überragenden Philosophen aus dem Ruhrgebiet heute noch genauso verbreitet ist wie damals. Die Sekundärliteratur ist immer noch genauso spärlich*, und es ist möglicherweise heute noch schwieriger die Originalausgaben von Kramskis Werken in Bibliotheken oder Antiquariaten aufzuspüren. Überflüssig anzumerken, daß von Neuauflagen oder gar Übersetzungen keine Rede ist. Wowereits Artikel ist deshalb, aller Knappheit und gelegentlichen Oberflächlichkeit zum Trotz, unverändert aktuell, und mag deshalb hier gleichsam als Mahnmal stehen.
Hans-Günther Wowereit
Wiktor Kramski – Nachdenklicher Vordenker
„Prawdopodobnie prawdy pragniemy.“
Wiktor Kramski, Co Ma Wiedzieć
Manch einem mag es abwegig erscheinen, ausgerechnet in Duisburg-Beeckerwerth mit der Suche nach dem Sinn des Lebens zu beginnen; aber gerade dort begann Wiktor Kramskis Suche. Ihm blieb nichts anderes übrig, denn dort begann sein Leben, und, wenn überhaupt, auch der Sinn desselben. Und, anders als allzuviele seiner neuzeitlichen Philosophenkollegen, scheute Kramski nicht davor zurück, diesen Sinn selbst zum Gegestand seines Denkens zu machen.
Wiktor Kramskis schriftstellerische Tätigkeit begann 1924 mit der Abhandlung Kritik der kleinen Vernunft. Schon in seinem Erstlingswerk bringt Kramski seinen unnachahmlichen Stil, zugleich polemisch und appelativ, zur Vollendung. So heißt es z.B gleich in der Einleitung: „Jetzt bitte ich Sie aber! Paul Natorp! Aus Düsseldorf! Das soll Philosophie sein? Denken Sie doch bloss mal!“1 Kramski entwickelt einige Thesen von außerordentlicher Originalität, so etwa daß Platon Legasteniker gewesen sei2. Sein nimmermüdes Engagement und der Wunsch, den Leser direkt in den Diskurs oder gar in den eigentlichen Denkprozeß miteinzubeziehen drückt sich allenthalben aus, nicht zuletzt in dem am Ende jedes der fünf Hauptkapitel gleichsam wie ein Mantra wiederkehrenden Satz: „Machen Sie sich darüber mal Gedanken!“3 Alles in allem ein vielversprechendes Werk für den am Beginn seiner Karriere stehenden Denker und Heizungsmechaniker.
Der Titel von Kramskis zweitem Werk, Sens Życia Bez Wątpienia [Der Sinn des Lebens ohne Zweifel], klingt ehrgeizig, zumal wenn man die Kürze des Traktats in Rechnung stellt (42 Seiten). Die zentrale These von Kramskis Argumentation erscheint auf den ersten Blick mehrdeutig: „Naprawdę życie bez wątpienia nie ma sensu.“4 Vor allzu voreiligen Schlußfolgerungen sei deshalb gewarnt: „Więc sens życia to wątpienie? Wątpię.“5 Kramski betont einen Aspekt der Problematik, der im philosophischen und weltanschaulichen Diskurs sonst allzu oft vernachläßigt worden ist: „Nie ma powodu przypuszczać że sens życia jest coś co możemy odkryć. Może już minął.“6 Ob es jedoch tatsächlich allein diesem Diktum Kramskis zuzuschreiben ist, daß der Inhaber des Lehnstuhls für tiefschürfende Philosphie an der Universität Łódź, Prof. Dr. Józef Jabłoński am 6. Februar 1927 die Fakultätsräume verriegeln ließ und verkündete, zum Philosophieren sei es jetzt sowieso zu spät7, muß dahingestellt bleiben.
Was also ist der Sinn des Lebens? In Wiktor Kramskis eigenen Worten, „trzeba żyć inaczej. To albo lepiej niż dotąd. Kto wie.“8 Und er fügt hinzu: „Pomysł nie nowy, ale traktat jest.“9
Erkenntnistheoretische Erkenntnisse, im darauffolgenden Jahr in Berlin veröffentlicht, greift die in Sens Życia Bez Wątpienia bereits in Ansätzen entwickelte Lehre vom Zweifel wieder auf und baut sie zu einer erkenntnistheoretischen Gesamttheorie aus. Die Erkenntnisse sind, von der Abschließenden unwissenschaftlichen Durchschrift abgesehen, Kramskis umfangreichstes Werk.
Kramskis eigenwillige Ontologie stuft den Schein höher ein als das Sein, und den Zweifel höher als das Denken. In seiner ausführlichen Explikation „Über den Zweifel“ im zweiten Hauptteil der Erkenntnistheoretischen Erkenntnisse verfolgt Kramski, wie schon Descartes, die Linie des methodischen Zweifels. Anders jedoch als Descartes findet Kramski keine unumstößliche Selbstgewissheit im Vollzug des Denkens an sich. Kramskis Zweifel ist weitergehend: Der Zweifel ist grundlegender als das Denken; Alles Denkbare läßt sich bezweifeln, aber nicht alles Zweifelhafte läßt sich auch denken10. Das bedeutet jedoch keineswegs, wie Wurstmann behauptet11, daß Kramski das cartesianische „Cogito ergo sum“ durch ein „Dubio ergo sum“ ersetzt. Kramski lehnt einen solchen euphorischen Skeptizismus ab. Für ihn ist der Zweifel wohl grundsätzlich, gründen läßt sich auf ihn jedoch nichts. Das „dubio“ führt in letzter Konsequenz zum „Dubio ergo dubio ut dubio“12. Begründet ist damit nichts. Nicht dem Zweifel an sich räumt Kramski Bedeutung ein (wie der Skeptiker es täte), sondern dem Bezweifelten, das durch den Zweifel auf eine logisch und ontologisch höhere Ebene gehoben wird. Ein „ergo“, d.h. eine jegliche Schlußfolgerung, ließe sich nur auf bezweifelte Prämissen gründen, glaubt und bezweifelt Kramski13. Nur das Bezweifelte kann Erkenntnis begründen, kann Sinn haben. Man mag solche Erkenntnis und solchen Sinn bezweifeln; um so besser: Quod erat demonstrandum. Der inhärente Zweifel ist eine Bedingung der Erkenntnis, und, wo es einen gibt, auch des Sinns.
Der nur 13seitige Artikel Prawda Streściona [Die Wahrheit, knapp zusammengefaßt] erschien 1930 im Duisburger Almanach für die polnische Familie. Leider wurde die gesamte Auflage des Almanachs, und mit ihr die komplette Wahrheit, von der Sonderkommission „Rabatz“ der sog. Polenüberwachungsstelle im Polizeipräsidium Bochum beschlagnahmt14 und gilt heute als verschollen.
Dieser Vorfall illustriert die Schwierigkeiten mit denen sich ein polnisch und deutsch schreibender Philosoph in den Endjahren der Weimarer Republik konfrontiert sah. Die Zeitumstände konnten auf einen so empfänglichen und weltoffenen Denker wie Wiktor Kramski, der sehr wohl voraussah, daß nicht nur für ihn, sondern für die gesamte Menscheit düstere Zeiten heraufzogen, nicht ohne Einfluß bleiben. Diesen Hintergrund muß man im Auge behalten, will man sich Kramskis rätselhafter und von Kritikern oft verworfenen Abhandlung Co Ma Wiedzieć [Was es zu wissen gibt] aus dem Jahre 1932 annähern. Co Ma Wiedzieć ist, wohl aufgrund seiner stellenweise wirren Struktur und einigen darin skizzierten abstrusen Theorien15, vorschnell als das Werk eines langsam dem Wahn anheimfallenden Geistes gesehen worden16; was sich jedoch in Wirklichkeit darin ausdrückt ist ein überaus wacher Geist, der verzweifelt versucht in einer dem Wahn anheimfallenden Welt noch Spurenelemente eines Sinns zu sehen.
Ein nicht zu unterschätzendes Problem für den Leser stellt der ungewöhnliche Stil dieser Abhandlung dar, nämlich scheinbar eine lange Aneinanderreihung unzusammenhängender Sätze. John M. Zinc interpretiert diese aneinandergereihten Sätze als unvollendete logische Dreisätze, bei denen jeweils die Schlußfolgerung ausgelassen sei, was aber, so Zinc, nicht weiter schlimm sei, denn: „..you get the drift anyway.“17 Als Beispiel gibt Zinc an: „Deszcz to do dupy. Dużo pada w Berlinie.“18 Es mag hier angemerkt sein, daß Zinc in der nämlichen Stelle im Übrigen einen Anklang an einen Gedankengang des irischen Denkers Eochaidh Ó hEodhusa sieht19. Die Tatsache, daß Zinc sich in seiner Argumentation auf keine andere Stelle beruft und keine weiteren Zitate bringt, veranlaßte Grzegorz Sztuhr (der ansonsten der Ansicht ist, Co Ma Wiedzieć habe keinerlei philosophischen Wert) zu der Vermutung, Zinc habe außer diesen beiden Sätzen überhauptnichts von Kramski gelesen20.
Kramskis Abhandlungen Der Anschein an sich (1933) und Popsucie Świata (1935) blieben bislang in ihren Originalen unveröffentlicht. Michalski, offensichtlich ohne die beiden Manuskripte je zu Gesicht bekommen zu haben, spekuliert, daß es sich hier wohl um noch wirrere Schriften handeln müsse als in Co Ma Wiedzieć21. Tatsächlich jedoch haben weder Der Anschein an sich noch Popsucie Świata auch nur die geringste stilistische oder inhaltliche Ähnlichkeit mit Co Ma Wiedzieć. Es handelt sich in beiden Fällen um äußerst scharfsinnige und stringent argumentierte Traktate, die nicht nur für das Verständnis von Kramskis Gesamtwerk, sondern für die gesamte Philosophiegeschichte der Neuzeit von elementarer Bedeutung sind. Im Übrigen sind natürlich die Hauptgedanken, und stellenweise ganze Argumentationsstränge, durchaus nicht wirklich unveröffentlicht geblieben, sondern sind in überarbeiteter Form in Kramskis monumentales Spätwerk, die Abschließende unwissenschaftliche Durchschrift, eingeflossen. Zu diesem, Kramskis Hauptwerk, gibt Der Anschein an sich das Hauptargumentationsgerüst ab. Es ist dies womöglich unter Kramskis denkerischen Errungenschaften die gewaltigste, nämlich die Ablösung der Ontologie durch die Apparologie. Anknüpfend an Kant, aber weitaus radikaler, arbeitet Kramski hier die Bedeutung des Anscheins gegenüber dem Sein an sich heraus. Ein großer Teil dieser Abhandlung taucht wörtlich in der Abschließenden unwissenschaftlichen Durchschrift wieder auf. Der Satz: „Sokrates sörte gnusen Organsuft“22 jedoch wurde in dieser Form nicht in die Durchschrift übernommen.
Popsucie Świata [Die Kaputtheit der Welt] ist wohl zurecht als Ausdruck von Kramskis Verzweiflung an der Welt gelesen worden23. Es muß als eine der großen verpaßten Gelegenheiten der europäischen Geistesgeschichte angesehen werden, daß Popsucie Świata auch nach Kriegsende unveröffentlicht blieb. Kramskis hellsichtige Worte hätten womöglich Horkheimer, Adorno und der gesamten Frankfurter Schule so manche Diskussion erspart. Die Hauptgedanken dieses Manuskripts sind in überarbeiteter Form in das 6. Kapitel („Das darf doch wohl nicht wahr sein“) der Abschließenden unwissenschaftlichen Durchschrift eingegangen.
Kramskis Briefwechsel mit dem polnischen Logiker Alfred Tarski begann bereits in den zwanziger Jahren, als letzterer noch in Warschau lehrte. Der Krieg und Tarskis Emigration nach Amerika erschwerte diesen fruchtbaren Gedankenaustausch. Nach Kriegsende jedoch nahmen die beiden Denker ihre Korrespondenz mit neuer Intensität wieder auf. Charles Muzyczecky vermutet, daß Tarskis Undecidable Theories (1953) stark von Co Ma Wiedzieć inspiriert ist24. Kramski verlor das Interesse an diesem Briefwechsel als ihm klar wurde, daß Tarskis Zylinderalgebra sich nicht auf Mützen anwenden läßt.
Nach langem Schweigen meldete sich Kramski mit der 1951 in Frankfurt/M. erschienenen Abschließenden unwissenschaftlichen Durchschrift um so deutlicher wieder zu Wort. Die Durchschrift sollte die große Synthese des kramski’schen Denkens werden, und insbesondere in der Lehre vom Anschein (Apparologie) stellt sie einen Höhepunkt der abendländischen Philosophie dar. Philosophen waren seit Heraklit zu sehr damit beschäftigt das wahre Wesen, die Essenz des Dings an sich vom bloßen Anschein abzugrenzen, als daß es ihnen in den Sinn gekommen wäre, daß auch der Anschein an sich ein wahres Wesen haben muß. Wiktor Kramski blieb es vorbehalten nachzuholen, was zweieinhalb Jahrtausende Philosophiegeschichte versäumt hatten.
Kramski geht entschieden weiter als Kant in seiner kritischen Periode. Kant hatte festgestellt, daß wir über das Ding an sich nichts aussagen können, sondern nur über das Ding wie es uns erscheint, uns angeht. Kramski nun kommt zu der Einsicht, daß das Ding an sich, sofern sein Wesen signifikant von seinem Anschein verschieden ist, nicht nur weniger Sinn hat als der Anschein (wie er im Anschein an sich bereits angemerkt hatte), sondern garkeinen Sinn. Der Sinn eines Dings, der nicht durch dessen Anschein ausgedrückt, sondern sogar von diesem verdeckt wird, ist wie der Sinn eines Satzes den niemand hört: wirkungslos und irrelevant. Ein solcher Sinn könnte nur im Ding an sich subsistieren. In einer breit angelegten Attacke auf die scholastische Ontologie, etwa im Gefolge eines Thomas von Aquin, weist Kramski jedoch logisch-semantisch auf, daß ein An-sich-Seiendes garnicht ist; denn: „Über das Seiende an sich kann ‚ist‘ nicht ausgesagt werden.“25 Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, daß das Ding an sich folgen- und wirkungslos bleibt. Als Beispiel hierfür gibt Kramski die mechanischen Puppen einer Geisterbahn an: Das Erschrecken, das sie als die Gespenster, die sie an sich garnicht sind, auslösen, ist real, wohingegen ihr mechanisches An-sich-Sein keine Wirksamkeit in der Welt entwickelt. Menschen handeln und fühlen aufgrund des Anscheins, nicht aufgrund des Dings an sich, und, so Kramski: „[…] das ist das blöde Ding ja auch selbst in Schuld wenn es nicht so scheint wie es ist. Was soll das denn auch.“26
Kramski blieb konsequent: Die Abschließende unwissenschaftliche Durchschrift schloss sein Schaffen ab. Kramski würde, wie sich seine Witwe Mathilde ausdrückte27, von nun an „das Denken drangeben“.
1962 veröffentlichte Heidegger seine Frage nach dem Ding. Kramski schäumte vor Wut und bezeichnete die Schrift als, so wörtlich, „dummes Zeug, und dann auch noch in so ein schlechten Stil“. Er selbst, Kramski, habe bezüglich des Dings doch schon alles gesagt, was es zu wissen gebe.
Die Aufregung tat ihm nicht gut. Wenige Wochen später starb Wiktor Kramski an Herzversagen.
Das Zitat; „Wenn Du zum Weibe gehst, vergiß die Seife nicht“ wird Kramski fälschlicherweise zugeschrieben.
* In der Tat haben unsere Recherchen ergeben, daß der vorliegende Artikel von Hans-Günther Wowereit anscheinend der bislang letzte veröffentlichte Artikel über Wiktor Kramski ist.
1 Wiktor Kramski, Kritik der kleinen Vernunft. Leipzig 1924; 2.
2 Vgl. ebd. 36ff.
3 Ebd. 32, 56, 89, 112, 203.
4 Wiktor Kramski, Sens Życia Bez Wątpienia. Oberhausen 1926; 11.
5 Ebd., 13.
6 Ebd., 27.
7 Vgl. dazu Grzegorz Sztuhr, Sens Życia Bez Wątpienia Wiktora Kramskiego – Oświecenie Sprzeczności. Gdańsk 1972; 178ff.
8 Kramski, Sens Życia, aaO. 36.
9 Ebd.
10 Vgl. Wiktor Kramski, Erkenntnistheoretische Erkenntnisse. Berlin 1927; 364ff.
11 Vgl. Johannes Wurstmann, Grundlegender Zweifel. Wessen sich Skeptiker sicher sind; in: Erkenntnistheorie von Aristoteles bis Wittgenstein. Wien 1951; 257.
12 Vgl. Erkenntnistheoretische Erkenntnisse aaO. 407.
13 Vgl. ebd., 613f.
14 Vgl. HStA Düsseldorf 13286, 165c.
15 Als Beispiel hierfür wird oft das sog. Relevanz-Axiom angeführt. Es beruht auf der alltäglichen Beobachtung, daß Personen und Dinge um so kleiner erscheinen, je weiter sie vom Beobachter entfernt sind, und umgekehrt. Der Kramski des Co Ma Wiedzieć jedoch weigerte sich, die übliche optische Erklärung für dieses Phänomen zu akzeptieren. Er bestand darauf, daß entfernte Personen und Dinge nicht nur kleiner erscheinen, sondern tatsächlich kleiner sind, und zwar weil sie mit zunehmender Entfernung unwichtiger werden. Kramski interpretiert die Größe eines Objekts als Funktion seiner Relevanz. Deshalb, so Kramski, seien nicht nur entfernte, und deshalb weniger relevante Objekte, sondern auch an sich nahe, aber irrelevante Gegenstände klein. Daher auch der erstmals von Kramski in die Fachdiskussion eingebrachte Terminus „Kleinkram“ (der wiederum einige sarkastische Kommentatoren dazu veranlasste, Kramski den Beinamen „Kleinkramski“ zu verpassen).
Es ist vielleicht nicht verwunderlich, daß gerade der Denker, der in der Abschließenden unwissenschaftlichen Durchschrift dem Anschein gegenüber dem Sein an sich zu seinem Recht verhelfen sollte, sich in diese Ecke denken konnte. Zu Kramskis Ehrenrettung sei hier jedoch darauf hingewesen, daß Kramski später unumwunden zugab, sich „verdacht“ zu haben.
16 Vgl. Piotr Michalski, Kramski Szaleje; in: Filozofia Westfalczyków, Warszawa 1933; 157.
17 Vgl. John Milton Zinc, An Unparalleled Compendium of the Humanly Knowable: Wiktor Kramski’s Co Ma Wiedzieć; in: Oxford Review 34 (1963); 65.
18 Co Ma Wiedzieć aaO. 169.
19 Eochaidh Ó hEodhusa (1567-1616) hatte in einer Parabel beschrieben, wie dreißig hervorragende Philosophen herausfanden, daß eine heranziehende Wolke einen schädlichen Regen herantrüge, der alle, auf die dieser Regen fiele des Verstandes beraubte. Die Philosophen versuchten ihre Mitmenschen zu warnen, doch niemand nahm ihre Argumentation ernst, und so nahmen nur sie selbst Unterschlupf in einer Höhle. Als der Schauer aufgehört hatte und sie wieder ins Freie traten fanden sie ihre Vorhersage bestätigt: Alle ihre Mitmenschen waren dem Wahnsinn anheimgefallen. Und so beschlossen die Philosophen der Wolke hinterherzueilen um selbst noch etwas von dem Regen abzubekommen, denn als einzige Vernüftige unter lauter Irren zu leben schien ihnen ein untragbares Los. So groß die Versuchung auch sein mag hier eine Parallele zu Kramski in den 30iger zu sehen , der die irre gewordene Welt nicht so einfach von der überlegenen Warte des Philosophen aus abtun konnte, sondern sich stattdessen gehalten sah, sie in einer (uns Heutigen, in einfacheren Zeiten Lebenden wirr erscheinenden) Abhandlung zu erklären: Zinc kann Ó hEochaidhs behaupteten Einfluß auf Kramski nicht ausreichend glaubhaft machen.
20 Vgl. Sztuhr aaO., 7.
21 Vgl. Michalski aaO. 156.
22 Der Anschein an sich, Ms. S. 89.
23 Vgl. Agnieszka Musorgska, Pocaj Mi Hegel; in: Co Za Głupota. Kraków 1955; 205.
24 Vgl. Charles Muzyczecky, Algebraic Semantics And Semantic Algebra. Berkeley 1965; 46.
25 Wiktor Kramski, Abschließende unwissenschaftliche Durchschrift. Frankfurt/M. 1951; 323.
26 Ebd. 254.
27 Interview mit dem Mathilde Kramski, 28.5.1960.