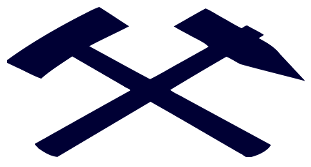Daß Sigismund Schimmelpoth Dichter würde war eigentlich niemals so gedacht. In seiner Jugend war der schmächtige Junge mehr dem Modellbau zugetan, wenngleich seine Leistungen auf diesem Gebiet wenig beeindruckend blieben. Gelegentlich waren die Ergebnisse seiner verbissenen Basteleien dermaßen mißraten, daß sie nicht selten im familiären Kreis Anstoß erregten, und mehr als einmal den häuslichen Frieden zu gefährden drohten. Die entscheidende Wende stellte wohl der Eklat am 12. April 1963 dar, als nämlich Karlheinz Brackmann, der damalige Hausfreund von Sigismunds Mutter, Medusa Schimmelpoth, das Ergebnis der Bemühungen des sensiblen Jünglings hinsichtlich des Faller-Bausatzes #7L307-C-75-B „Steinbach Hbf.“ mit der Replik „Was ist das denn für ’ne Kacke“ bedachte. Diese Worte sollten später von dem zur Reife gelangten Dichter unsterblich gemacht werden.
Doch wie wurde aus diesem verschüchterten Stubenhocker der wortgewaltige Literaturgigant Sigismund Schimmelpoth, dessen Verse wie die keines anderen der Beschissenheit der Postmoderne als Epoche sowie dem Kacke-Sein des Daseins im Allgemeinen Ausdruck verliehen haben? Das Verdienst, den widerwilligen Schimmelpoth mit Gewalt festgehalten zu haben, während ihm die Muse einen dicken feuchten Schmatzer auf die Lippen drückte, gebührt Rudibert von Schwölz, Kreditsachbearbeiter an der Kreissparkasse Gelsenkirchen. Schimmelpoth war Ende der achtziger Jahre hoch verschuldet, als Folge eines fehlgeschlagenen Investmentplans, in den er sich von seinem Schulfreund Jürgen W. Möllemann hatte verwickeln lassen, und der allem Anschein nach mit dem Schicksal eines umstrittenen Fußballvereins verknüpft war. Die Freundschaft zwischen Schimmelpoth und Herrn Möllemann kühlte nach diesem Vorfall merklich ab, wofür auch einige Zeilen aus Schimmelpoths „Ode an die ziemlich miese Stimmung“ Zeugnis ablegen. Doch, wie so viele Zeilen aus dem bis heute seine Rätselhaftigkeit bewahrenden Werk Schimmelpoths, so ist auch die infrage stehende Zeile der „Ode“ in der Literaturkritik immer noch Gegenstand lebhafter Diskussion. So spielt z.B. Prof. Yrjö Hirn vom Institut für kontextuelle Studien in Tampere die Bedeutung des Investmentplans und der darauffolgenden Spannungen zwischen den beiden Männern herunter, indem er darauf hinweist, daß sich Schimmelpoths Würgereiz ohne weiteres aus der Gegenwart Möllemanns an sich hinreichend erklären lasse. Ernst Mackhardt wiederum, dessen ätzende Kritik am Schimmelpoth’schen Oeuvre sich nur als persönlicher Rachefeldzug erklären läßt, stellt in seinem Beitrag „Ich geb dir gleich Ode“ in der Festschrift für Prof. Otto Klamunke die absurde Behauptung auf, daß der Dichter sich einzig und allein deshalb des Begriffs „würgen“ bedient habe, weil der sich auf Möllemanns Vornamen reime, und umgekehrt. Rudibert von Schwölz nun, der mit der Eintreibung von Schimmelpoths beträchtlichen Schulden betraut war, war privat sehr im Kampf gegen den kulturellen Verfall des Abendlandes im Allgemeinen, und Gelsenkirchens im Besonderen, engagiert, und war Gründungsvorsitzender des VST Gelsenkirchen (eigentlich: Verein für damit die deutsche Sprache nicht kaputtgesprochen wird von so ein paar Trottels e.V.). Schimmelpoths von tadelloser Diktion geprägte Bittbriefe und seine treffsichere Wortwahl überzeugten von Schwölz davon, daß er es hier mit einem der wenigen noch verbliebenen kompetenten Muttersprachler des Deutschen zu tun hatte. Unter Mißachtung sämtlicher Dienstvorschriften stellte er Schimmelpoth vor die Wahl, entweder mit der Muse oder mit dem Gerichtsvollzieher nähere Bekanntschaft zu machen. Und so wurde Sigismund Schimmelpoth zum Dichterfürsten des Gelsenkirchener Barocks, zum Poeten wider Willen. Von Schwölz‘ Einfluß ist wohl auch das sprachtheoretische Verswerk „Why ‚-nachten‘?“ zuzuschreiben, in dem Schimmelpoths inquisitives Genie bis ins Innerste der Sprache vordringt. Der Vorfall, auf den sich Schimmelpoths wohl intensivste Dichtung, das als „existentieller Aufschrei“ beschriebene Epos „Feuer im Foyer“ bezieht, ist, entgegen den Behauptungen Heinrich Wagenbriechts in seiner Studie „Zwischen Wackelpudding und Apokalypse – Das Dessert an und für sich im Werk Sigismund Schimmelpoths“, rein fiktiv. Schimmelpoth hat nie ein Foyer gehabt, was auch das offizielle Bauregister der freien Hansestadt Gelsenkirchen bestätigt. Aber er hätte gerne. Die Enttäuschung darüber, daß dieser Traum angesichts seiner sich täglich verschlechternden Kreditlage in unerreichbare Ferne gerückt war, war es dann wohl auch, was diesen „existentiellen Aufschrei“ provoziert hat. Gerade hier jedoch offenbart sich des Dichters größter Geniestreich, die ontologische Umwertung des Begehrten, aber für immer Unerreichbaren, in ein ideelles Schon-einmal-Gehabtes-und-wieder-Verlorenes. Wer dies, wie Ernst Mackhardt in seinem von charakteristischer Gehäßigkeit geprägten Artikel „Schimmelpoth, dat blöde Arschloch“ im Jubiläumsband „20 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bochum-Harpen“ des „Hiltroper Vor-Boten“ als „metaphysischen Taschenspielertrick“ abqualifiziert, übersieht die lange Reihe der literarischen und geistesgeschichtlichen Tradition, in der Schimmelpoths Meisterwerk steht, und die sich bis zum biblischen Buch Genesis mit seiner tiefempfundenen Beschreibung des paradiesischen Idealzustandes unserer in Wirklichkeit doch so unvollkommenen Welt als schon-einmal-gehabt-und-wieder-verloren, zurückverfolgen läßt. Schimmelpoths schon von vorneherein als verloren erträumtes Foyer, samt Styroplast Deckenverkleidung, ist der letzte Rest dessen, was sich dieser zutiefst pessimistische Dichter unseres desillusionierten Zeitalters noch zu träumen erlaubt; Das Foyer ist, so kann man sagen, das verlorene Paradies des frustrierten kleinen Mannes.